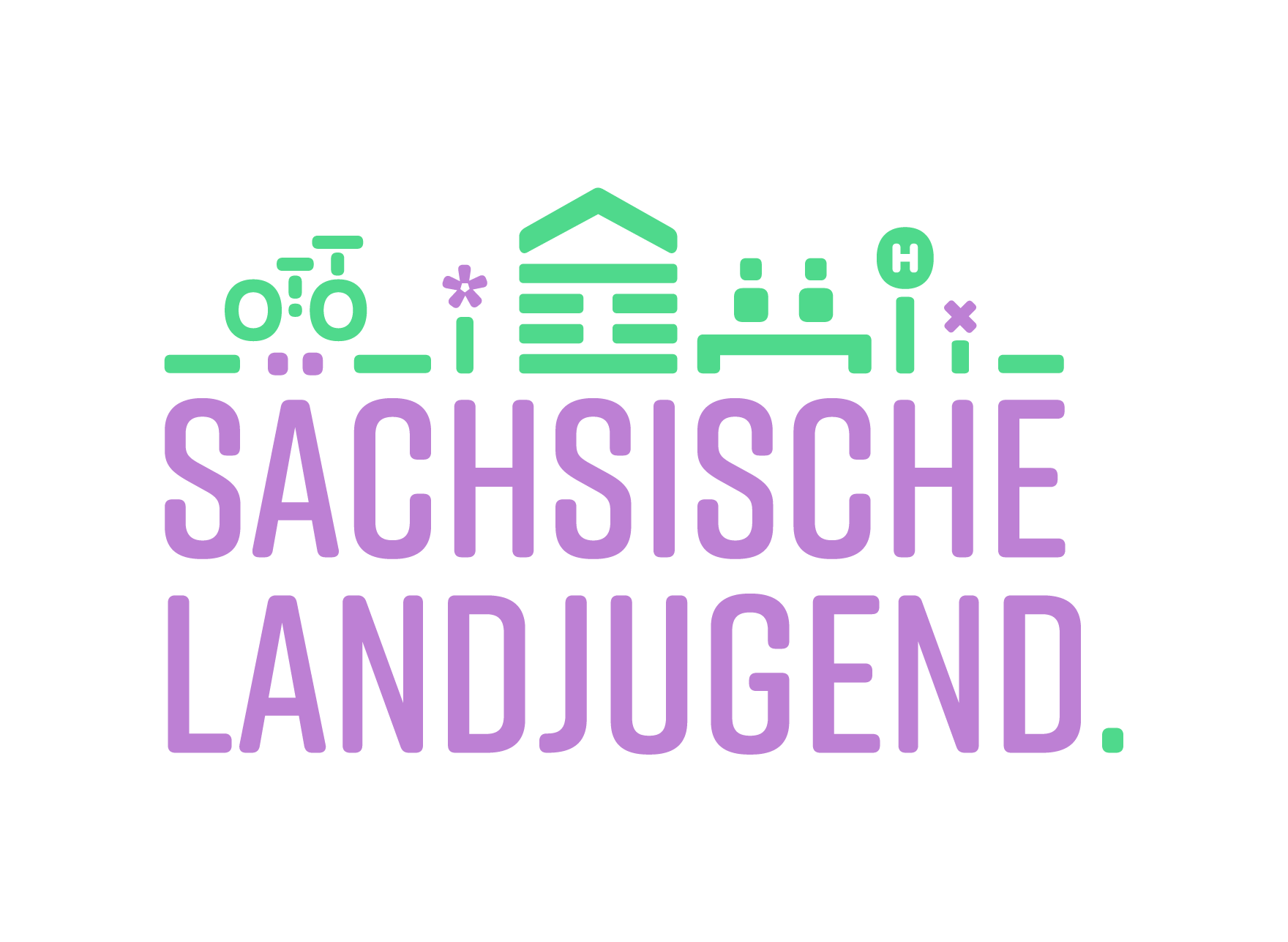Glossar
Hier erhaltet ihr einen Überblick über wichtige Fachbegriffe Smarter Jugendarbeit.
Digitalisierung
Unter Digitalisierung werden vor allem Prozesse auf technischer Ebene verstanden: Diese Prozesse umfassen die Umwandlung von analogen Daten in digitale Daten, die auf digitalen Endgeräten gespeichert, verarbeitet und übertragen werden. Z.B. werden analoge Bücher digitalisiert (E-Books); Schultafeln werden gegen smarte Tafeln ausgetauscht; Kommunikation findet zunehmend digital statt (Chat über Messenger, E-Mail, usw.) oder eine Umfrage, die vormals mit Zettel und Stift ausgefüllt wurde, wird mittels eines Tools oder App digital durchgeführt (z.B. tricider).
Mit der Verwendung des Begriffs Digitalisierung werden eher die infrastrukturellen, administrativen und organisationalen Prozesse der Digitalisierung fokussiert (wenn sich z.B. ein Träger eine Serverfarm zulegt, dann passiert das auf Prozessebene der Digitalisierung).
Digitalität
Mit der Verwendung des Begriffs der Digitalität wird vor allem die kulturelle und gesellschaftliche Ebene der Digitalisierung relevant und der Fokus darauf gelegt, was sich aus einer gesellschaftlichen und kulturellen Perspektive verändert: Wie verändern sich zwischenmenschliche Beziehungen wenn zunehmend digital kommuniziert wird? Wie verändern sich Lebens- und Alltagswelten der Adressat:innen? Wie gehen wir mit digitalen Medien um?
Digitale Medien werden in dieser Lesart nicht als rein technische Artefakte, sondern als integraler Bestandteil von sozialen Kommunikations- und Erfahrungsräumen betrachtet. Der Kultur- und Medienwissenschaftler Felix Stalder hat sich intensiv mit der gegenwärtigen Kultur der Digitalität auseinandergesetzt und identifiziert drei Grundfomen, die darin zum Tragen kommen: Referentialität, Gemeinschaft und Algorithmizität. Sie alle prägen die Strukturen und Nutzung von digitalen Medien.
Mediatisierung
Der Mediatisierungsansatz, der auf den Kommunikationswissenschaftler Friedrich Krotz zurückgeht, befasst sich mit dem Wandel von Alltag und sozialen Beziehungen, Gesellschaft und Kultur im Kontext des Wandels der Medien. Mediatisierung ist als Metaprozess zu begreifen: Mediatisierung ist weder räumlich noch zeitlich begrenzt und reicht auf Entwicklungen noch vor Erfindung der Schrift zurück.
Die Digitalisierung ist im Kontext von Mediatisierung eine Phase in einem bereits länger laufenden Mediatisierungsprozess. So lassen sich (scheinbar) neuartige Phänomene in einen übergeordneten, historischen Prozess einorden.
analog/digital
Auf technischer Ebene bezeichnet das Begriffspaar analog/digital zunächst einmal die Art und Weise wie mittels eines Signals Information übertragen wird: Digitale Medien zerlegen jeden Inhalt in Schritte mittels eines binären Codes; analoge Medien prozessieren, übertragen und speichern ihre Signale kontinuierlich (Lautstrom der Stimme, Radiowelle, analoges Fernsehen).
Bei der Nutzung von digitalen Kommunikationsmedien finden meistens mehrere Umwandlungsprozesse statt: das analoge Stimmsignal wird vom Smartphone als digitales Signal übertragen und schließlich vom Smartphone des Anderen wieder in ein analoges Signal umgewandelt. Deshalb ist es schwer nur von rein analoger oder rein digitaler Kommunikation zu sprechen. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich aber der Begriff der digitalen Kommunikation durchgesetzt, sobald ein entsprechender Umwandlungsprozess stattfindet.
Auf der anderen Seite sind in scheinbar rein analogen Vermittlungsprozessen auch digitale Techniken enthalten, so etwa in den Sprach- und/oder Kommunikationswissenschaften: Einige Theoretiker:innen (z.B. Paul Watzlawick) sehen sogar in der Schrift bzw. Sprache digitale Techniken: die Buchstaben des Bezeichneten (z.B. K-a-t-z-e) haben bspw. per se wenig etwas mit dem eigentlichen Tier Katze zu tun, sondern folgen lediglich einer semantischen Beziehung, die dem digitalen binären Codierungsprozess ähnlich sind.
physischer Raum/Virtueller Raum
Wenn wir von Räumen sprechen, werden diese – entgegen der geläufigen Umgangssprache – nicht in analoge oder digitale Räume aufgeteilt (da analog/digital per se nur auf die Form der Übertragung von Signalen verweist). Vielmehr handelt es sich um physische und virtuelle Räume. Physisch meint alles was ich haptisch wahrnehmen kann. Oft spricht man von physisch-materieller Welt bzw. Räumen. Wenn zwei Personen im physischen Raum aufeinander treffen, erfordert dies eine leibliche Ko-Präsenz, d.h. sie existieren mit ihren haptisch wahrnehmbaren Körpern zur gleichen Zeit am gleichen Ort.
Virtuelle Räume entstehen durch die Simulation mittels digitaler Medien. Sie bestehen aus medial konstituierten Umgebungen, die es Menschen mittels Schnittstellen bzw. Eingabehilfen erlauben, sich in ihnen bewegen zu können (z.B. in einem Computerspiel) oder mit anderen zu kommunizieren und Informationen auszutauschen (z.B. Soziale Netzwerke wie YouTube oder TikTok).
hybrid
Mit dem Begriff hybrid wird die Verflechtung von analogen und digitalen Dimensionen auf einer Wahrnehmungsebene beschrieben, wobei es nicht nur um eine additive (analog+digital) Wahrnehmung geht, sondern die Dimensionen untrennbar ineinander verwoben sind. Der Begriff weist oft auf räumliche Verschränkungen hin: Jugendliche, die sich physisch an einem Ort (z.B. Jugendtreff) befinden und miteinander face-to-face kommunizieren, machen mit ihren Endgeräten mittels Messenger-Apps z.B. weitere Kommunikationsräume auf, die nicht an physische Räume gebunden sind. Somit sprechen wir von hybriden Kommunikationsräumen.
Mit der Perspektive des Hybriden wird sich gegen Dichotomien wie physisch vs. virtuell bzw. analog vs. digital verwehrt, da sämtliche Praktiken und Lebenswelten mit digitalen Medien verschränkt sind:
Das sich Begeben in virtuelle Räume hat durchaus eine physisch-materielle Ebene: z.B. kann die Sitzposition mein Computerspiel beeinflussen; oder die Nahkörpertechnologien wie Smartphones dienen als Schnittstellen zu virtuellen Räumen im physisch-materiell begrenzten Raum des Jugendtreffs.
Digitale Ungleichheit
Unter der Überschrift digitale Ungleichheit werden
a) Aspekte des Zugangs zum Internet und dem Zugang zu digitalen Endgeräten beschrieben,
b) die Unterschiede in der Mediennutzung thematisiert,
c) Differenzierungen ausgehend von Infrastruktur und Algorithmen fokussiert.
a) hier wird von digitaler Kluft oder digitaler Spaltung gesprochen. Die Unterschiede bestehen innerhalb von Regionen und zwischen verschiedenen Gebieten. So haben 80 % der Menschen in Europa Zugang zum Internet. In Afrika sind es deutlich weniger. Ein anderer Aspekt hierbei ist ein sozialer. So haben Menschen mit geringerem Einkommen weniger Möglichkeit Hardware und Zugang zu finanzieren. Auch genderbezogen kann von einer digitalen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern gesprochen werden. Ein dritter Aspekt ist das Alter.
b) dieser Aspekt beschreibt ein unterschiedliches Nutzungsverhalten aufgrund unterschiedlicher Bildungsbiographien. Dieses Verhalten kann z.B. hinsichtlich der Themenwahl, der Einschätzungen zur Glaubwürdigkeit von Medien und des Maßes aktiver Beteiligung differieren. Eine sehr aktuelle Folge dieses Aspektes ist eine Demokratiekluft, dass heißt z.B. werden demokratische Beteiligungsmöglichkeiten im Internet mangels Kenntnis bzw. Kompetenz nicht genutzt.
c) unter diesem Fokus werden Aspekte diskutiert, die sich aus der Struktur von Plattformen und den dort verwendeten Algorithmen ergeben. Neben personalisierten Nutzer:innen-Profilen kommen hier die sogenannten Filterblasen in den Blick, die zu unterschiedlichen (und mitunter diskriminierenden) Empfehlungslogiken führen können.
Digital Detox
Mit „Digital Detox“ wird eine bewusste Auszeit von digitalen Geräten und Online-Aktivitäten bezeichnet. Als Ziel wird formuliert, die Abhängigkeit von Technologie zu reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern. In einer Zeit, in der Smartphones, soziale Medien und ständige Erreichbarkeit unseren Alltag dominieren, zielt Digital Detox darauf ab, den Fokus auf persönliche Interaktionen, Entspannung und Selbstreflexion zu legen. Erwartete Effekte einer solchen Auszeit sind die Stärkung mentaler Gesundheit, der Abbau von Stress und die Wiederherstellung der Verbindung zur physischen Welt. Oft wird empfohlen, feste Zeiten oder Tage ohne digitale Geräte einzuplanen, um die Vorteile eines solchen Verhaltens zu erleben.
Kritisch zu betrachten ist die unreflektierte Verwendung des Begriffs Detox – Entgiftung. Dieser kommt aus der Arbeit mit Menschen, die einen problematischen Umgang mit psychoaktiven Substanzen pflegen. Die – wenn auch exzessive – Nutzung von digitalen Medien mit Vergiftung gleichzusetzen, scheint zu verkürzt. Darüber hinaus ist eine völlige Abstinenz von allem Digitalem in einer digitalisierten Welt sehr anspruchsvoll und es besteht die Gefahr sozial isoliert zu werden, da Kommunikation heute in hohem Maße mittels digitaler Medien stattfindet.
Grundsätzlich steht hinter dem Konzept von Digital Detox der stehende Impuls zur Reflexion des eigenen Verhaltens im Fokus. Der begrifflich bedingte mitschwingende Duktus des „Heilkonzeptes“ ist jedoch kritisch zu betrachten.
KI - "Künstliche Intelligenz"
Künstliche Intelligenz (KI) ist die deutsche Übersetzung des englischen Artificial Intelligence. Intelligenz meint hier die Sammlung, Analyse und Verarbeitung von Daten, nicht die umfassendere Bedeutung im Deutschen. (bildhafter: Das „I“ in CIA steht für „Intelligence“. Die Abkürzung CIA steht also für „Central Intelligence Agency“, was auf Deutsch „Zentrale Nachrichtenagentur“ bedeutet. Die CIA ist eine US-amerikanische Behörde, die für die Sammlung, Analyse und Verbreitung von Informationen über ausländische Regierungen, Unternehmen und Einzelpersonen zuständig ist.)
Definition: Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet die Fähigkeit von Systemen und Algorithmen, menschenähnliche Intelligenzleistungen zu erbringen, wie Lernen, Problemlösen, Sprachverstehen und Schlussfolgern. Sie nutzt Algorithmen (komplexe Modelle) und große Datenmengen, um Muster zu erkennen und Aufgaben autonom oder semi-autonom auszuführen.
Open Source
Quelloffenheit, allgemein als „Open Source“ bekannt, ist mehr als nur eine technische Vorgehensweise; sie ist eine Philosophie, die den freien Zugang und die gemeinschaftliche Entwicklung von Software in den Mittelpunkt stellt.
Im Kern bedeutet Quelloffenheit, dass der Quellcode einer Software öffentlich zugänglich ist, wodurch eine transparente und kollaborative Umgebung entsteht. Jede Person, die sich dafür interessiert, kann an der Entwicklung teilnehmen, Fehler beheben, neue Funktionen hinzufügen und die Software an seine spezifischen Bedürfnisse anpassen.
Ein wesentlicher Vorteil von Open-Source-Software ist ihre kostenfreie Nutzbarkeit und Weitergabe, wobei die jeweiligen Lizenzbedingungen zu beachten sind. Dieses Modell steht im Kontrast zu proprietäre (im Eigentum befindlicher) Software und fördert Innovation durch die gemeinschaftliche Anstrengung und den freien Austausch von Wissen und Ideen.
Freie Software
Freie Software ist Software, die die Freiheit und Gemeinschaft der Nutzer:innem respektiert. Ganz allgemein bedeutet das, dass Nutzer:innen die Freiheit haben Software auszuführen, zu kopieren, zu verbreiten, zu untersuchen, zu ändern und zu verbessern. Freie Software ist daher eine Frage der Freiheit, nicht des Preises.
Mit diesen Freiheiten kontrollieren Nutzer:innen (sowohl einzeln als auch gemeinsam) das Programm und was es für sie ausführt. Wenn nicht Nutzer:innen das Programm kontrollieren, gilt es als unfreies bzw. proprietäres (im Eigentum befindliches) Programm. Das unfreie Programm kontrolliert die Nutzer:innen, und die Entwickler:innen kontrollieren das Programm. Dies macht das Programm zu einem Instrument ungerechter Macht.
Zur Unterscheidung derartiger Software von derjenigen, die als Open Source bezeichnet wird:
Im Kern ist zweitere einfach frei zur Weiterverarbeitung. Dadurch können auch Produkte entstehen, die nur zu kaufen sind, die keinen offene Quellcode mehr haben, und auch nicht zwangsläufig die selbe Freigabe-Lizenz haben müssen. Freie Software muss auch mit ihren Weiterentwicklungen immer frei bleiben, sie darf nicht für solche eben beschriebene Software verwendet werden.
Außerdem darf freie Software nicht dafür genutzt werden, Machtgefälle herzustellen – also beispielsweise Überwachungssoftware zur Kontrolle von Tätigkeiten anderer Menschen oder ähnliches beinhalten.
Digitale Souveränität
Digitale Souveränität bezeichnet die Fähigkeit von Individuen, Organisationen und Staaten, die Kontrolle über ihre digitalen Daten und Technologien zu behalten.
Sie umfasst den Schutz persönlicher Informationen, die Gewährleistung von Datensicherheit und die Unabhängigkeit von externen Anbietern.
Für Fachkräfte in der Jugendarbeit ist es wichtig, digitale Souveränität zu fördern, um jungen Menschen zu helfen, informierte Entscheidungen über ihre Online-Präsenz zu treffen und ihre Privatsphäre zu wahren. Ziel ist es, die Selbstbestimmung im digitalen Raum zu stärken und Abhängigkeiten zu reduzieren.